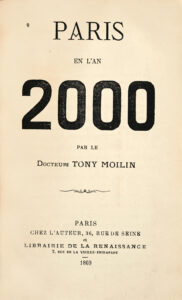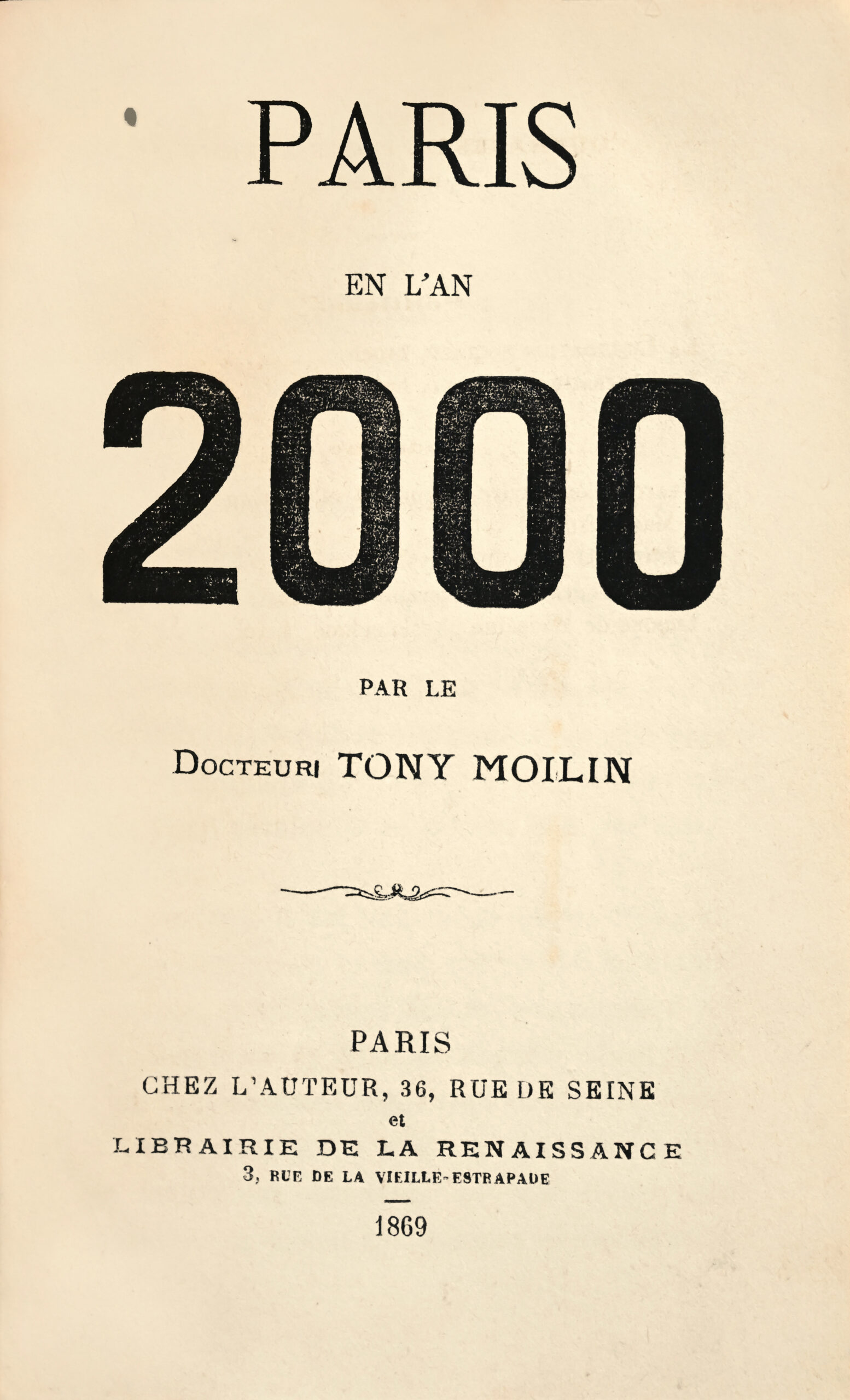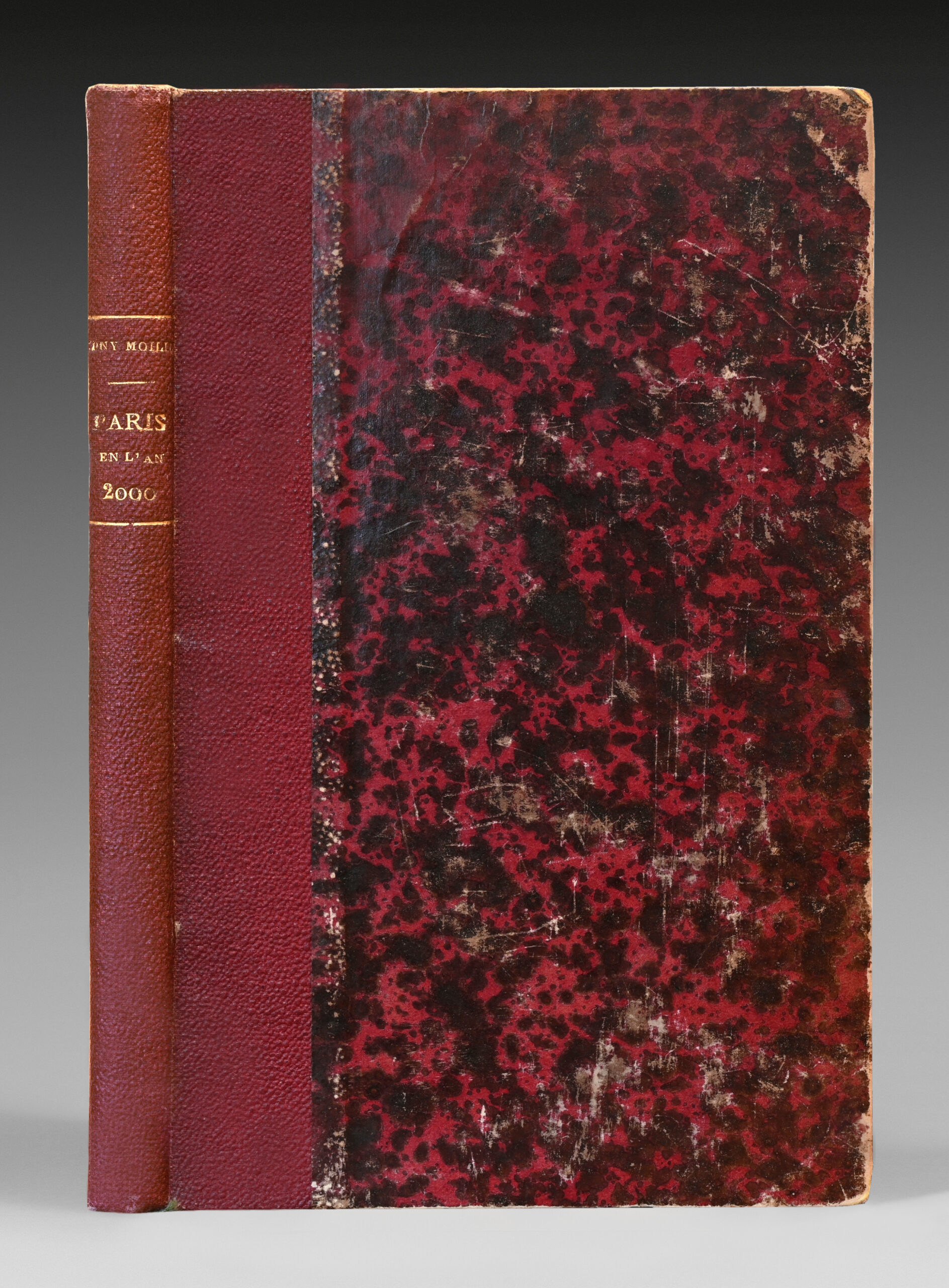Paris, beim Autor & Buchhandlung der Renaissance, 1869.
In-12 von (2) Blättern, 188 S. Halbleinen Bordêux, glatter Rücken. Bindung der Zeit.
176 x 108 mm.
Edition originale de cette importante et rarissime utopie dans laquelle l’auteur décrit la capitale de la fin du XXe Die von ihm beschriebenen Straßengalerien sind stark von dem Werk von Charles Fourier inspiriert.
Das utopische Paris dieses Werkes wird in sechs Kapiteln ausführlich dargestellt: Transformation von Paris, Arbeitsorganisation, Gesellschaft, Bildung, Regierung & Religion und Sitten.
Tony Moilin war Verteidiger der Pariser Kommune. 1869 schrieb er eine Zukunftsvision, die von den saint-simonistischen und fourieristischen Einflüssen geprägt war, die er verkörperte.
L’auteur s’affirme convaincu que “l’humanité touche à un instant suprême, instant unique de l’histoire, où vont se réaliser toutes les espérances des siècles passés [.] C est en France, c’est à Paris que doit commencer cette rénovation sociale et de là elle se propagera aux nations voisines et finira par envahir tout l’univers.”
Jules Antoine Moilin, genannt Tony Moilin, war ein philanthropischer Arzt und Utopist, der während der Pariser Kommune erschossen wurde. Er war Schüler und dann Assistent von Claude Bernard. 1865 zeichnete er sich durch sein Engagement während einer Choleraepidemie aus und auch durch seine Pflege der Armen in den Pariser Ambulanzen.
Im August 1870 stand er mit etwa fünfzig weiteren Angeklagten vor einem hohen Gericht, das ihn wegen Beteiligung an einem angeblichen Komplott gegen das Leben von Napoleon III. zu fünf Jahren Haft verurteilte. Er wurde einen Monat später mit dem Sturz des Reiches freigelassen.
Tony Moilin habitait en 1870, 36, rue de Seine-Saint-Germain, à Paris, et s’était fait connaître à la fin de l’Empire. Professionnellement d’abord : il donnait des soins dans deux dispensaires, rue de Rivoli et rue de Seine ; élève de Claude Bernard, médaillé pour son dévouement lors de l’épidémie de choléra, il avait découvert un remède contre les maux d’yeux et passait pour un médecin distingué, jouissant d’une assez grande aisance. Ses opinions socialistes n’étaient pas nées de la misère ou du spectacle de la misère ; elles commencèrent à se manifester, à prendre corps peut-être, vers 1868 ; il donna alors tout un programme de discussions pour les Sociétés populaires : projet de Banque du peuple d’inspiration proudhonienne, à la salle Molière ; d’instruction publique, à Ménilmontant – projet dont l’enseignement moderne s’écarte fort peu ; discussion sur l’octroi, salle de la Reine-Blanche. Cet homme de taille élancée, aux longs cheveux bruns, au teint pâle, à la barbe blonde peu épaisse, se prodiguait sans compter malgré son air souffrant. Il jugêit le moment favorable pour bousculer la société « détestable, foncièrement détestable » (La Liquidation sociale, op. cit.) puisque fondée sur l’inégalité. La génération de 1869, « froide, résolue, calculatrice, et pourtant susceptible d’enthousiasme » doit relayer celle de 1848 et mettre fin à l’expérience manquée des dix-huit siècles de christianisme. Le système qu’il préconisait n’était pas utopique bien qu’il se bornât à énoncer des principes généraux : le capital peut subsister, les prix doivent être calculés de façon à échelonner les revenus annuels de 2 400 à 12 000 f ; l’impôt joue là un rôle régulateur. Il avait une conscience aiguë que « l’humanité touche à un instant suprême, instant unique de l’histoire, où vont se réaliser toutes les espérances des siècles passés […] C’est en France, c’est à Paris que doit commencer cette rénovation sociale et de là elle se propagera aux nations voisines et finira par envahir tout l’univers » (Ibid.).
Bei den komplementären Parlamentswahlen im November 1869 in Paris wurde er als sozialistischer Kandidat vorgestellt; im Prozess von Blois wurde er beschuldigt, den Revolutionären chemische Formeln übermittelt zu haben, und zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Während der Belagerung war er Mitglied des Zentralkomitees der zwanzig Arrondissements für das VI. Arrondissement und zeichnete als einer der Unterzeichner der roten Plakate vom 6. Januar 1871, in denen das Volk von Paris vor dem “Verrat” der Regierung vom 4. September gewarnt wurde und drei Parolen in den Vordergrund rückte: Allgemeine Requisition, kostenlose Rationierung, Massenangriff. Diese endete mit den Worten: “Platz dem Volk! Platz der Kommune!” Siehe Ansel.
Am 18. März 1871 nahm Tony Moilin an der Besetzung des Rathauses des VI. Arrondissement teil und blieb dort einige Tage; er war (Dekret vom 21. April) Oberarzt des Bataillons seines Viertels, des 193. (ihm wurde auch der Posten des Generalinspekteurs der Militärkrankenhäuser angeboten). Am 12. Mai wurde er zur Gemeindekommission des XII. Arrondissement berufen und von Henriet als Assistenzarzt des 193. Bataillons ersetzt. Er fand vom 21. bis zum 27. Mai Zuflucht, doch an diesem Datum bat ihn der besorgte Freund, der ihn beherbergte, zu gehen; er wurde von einem Kollegen verraten und von Hauptmann Garcin am Abend um 9 Uhr verhaftet, der ihn vor das Kriegsgericht von Luxemburg brachte.
Man warf ihm weniger seine Taten – der einzige Vorwurf war seine sehr kurze Zugehörigkeit zur Gemeinde Saint-Sulpice – als seinen politischen Einfluss vor. Er wurde zum Tode verurteilt, und die einzige Milderung bestand in einem Aufschub von wenigen Stunden, auf das dringende Ersuchen von Hérisson, der wieder Bürgermeister des VI. war: Tony Moilin konnte so seine schwangere Gefährtin heiraten.
Er wurde am Morgen des 28. hingerichtet, gelehnt an den Sockel des Löwen, der links den Eingang der Avenue de l’Observatoire bewacht. Man hatte seiner Witwe versprochen, ihr den Körper zu übergeben, aber um ihm das Prestige des Märtyrers zu verwehren, wurde er in ein Massengrab geworfen, und das zu seiner Erinnerung errichtete Monument auf dem Friedhof Montparnasse bleibt leer.
Wertvolles Exemplar dieser äußerst seltenen Utopie, erhalten in seinem zeitgenössischen Einband.